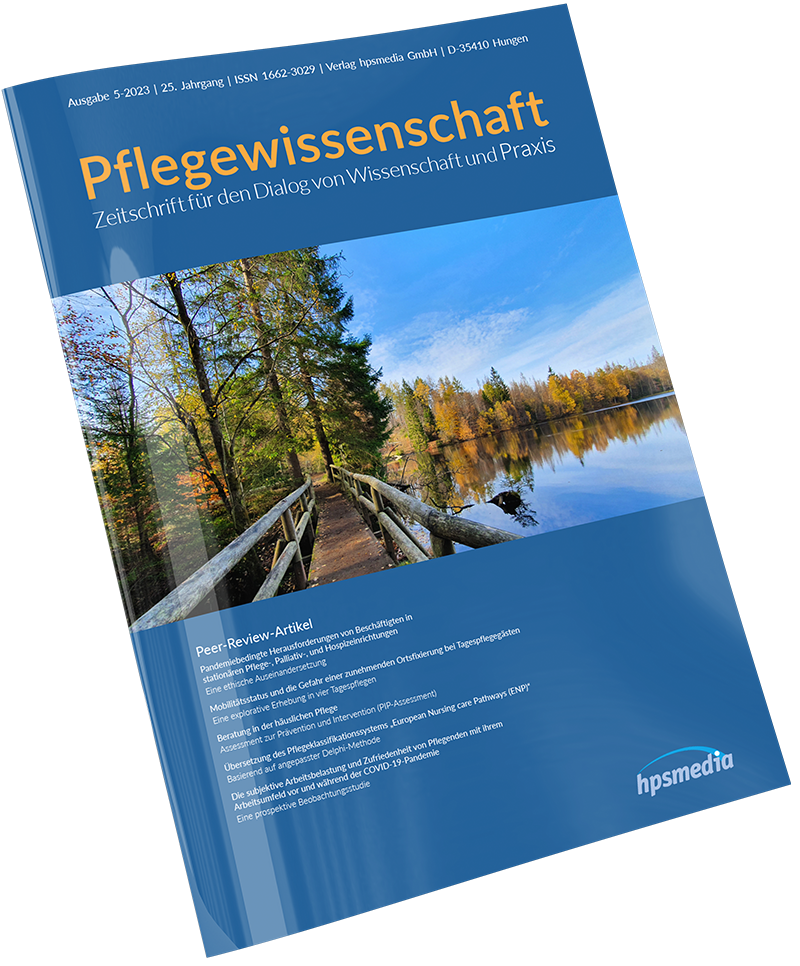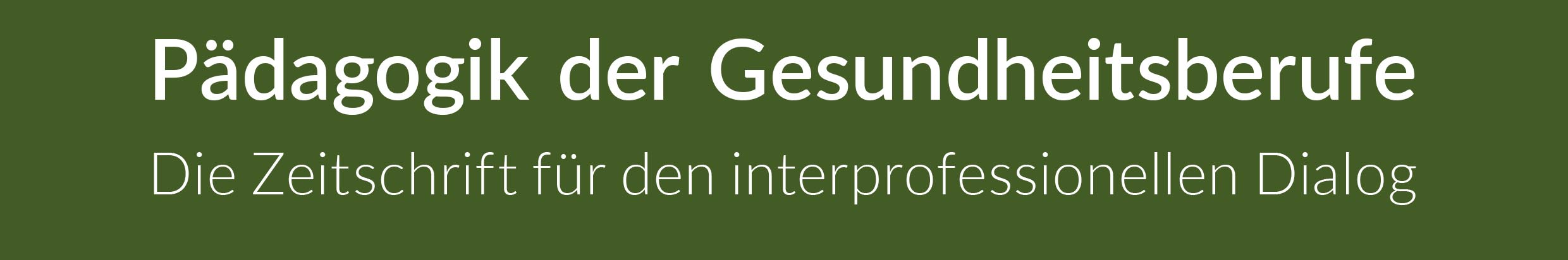Willkommen in der Manuskriptzentrale von hpsmedia
Zeitschriften
-
Pflegewissenschaft
Pflegewissenschaft ist die interntionale, peer-reviewte Fachzeitschrift für alle Berufe der Pflege. Sie möchte einen Beitrag für Wissenschaft, Forschung und Praxis des Pflegeberufes leisten sowie Praktikern konkrete Hilfen und Anregungen geben.
Die Zeitschrift Pflegewissenschaft erscheint alle 2 Monate im Umfang von ca. 80 Seiten als Print- und Online-Ausgabe. Die Nutzung der Online-Ausgabe umfasst das komplette Archiv ab der Erstausgabe.